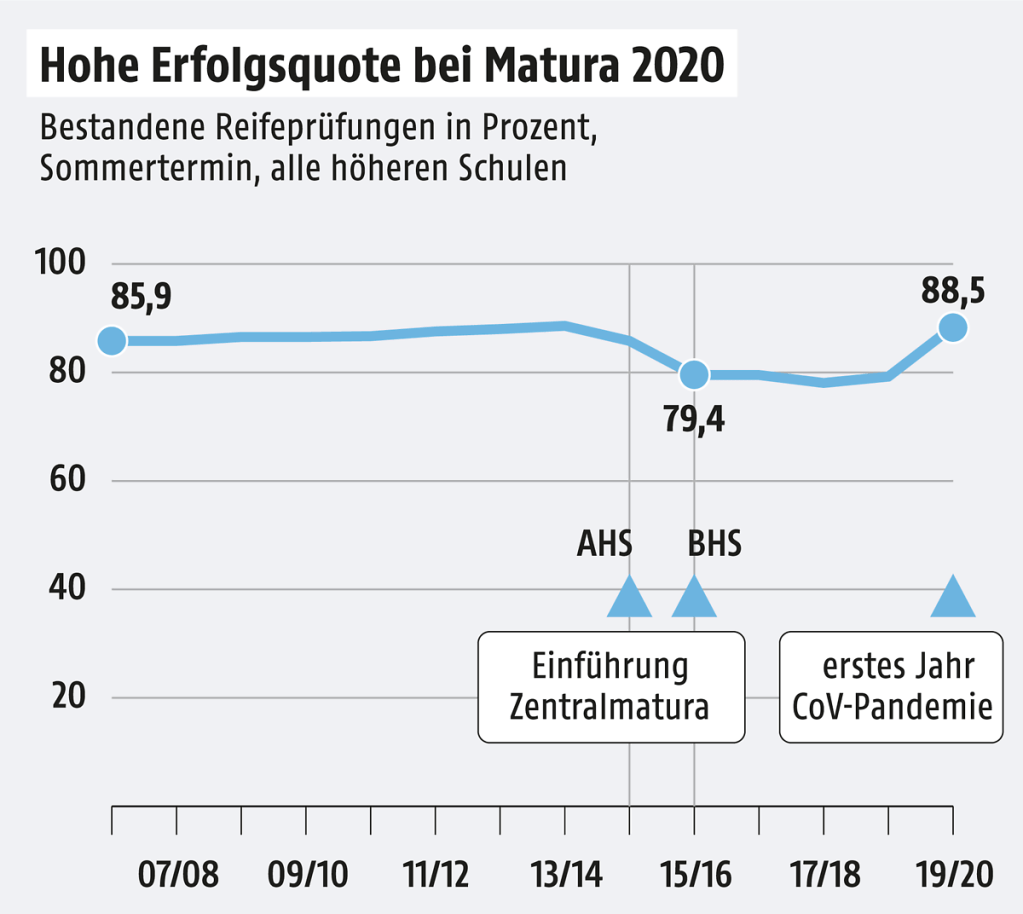Ich lese gerade ein Buch des US-Politikers Bernie Sanders. Ich habe es schon vor einer ganzen Weile in der Buchhandlung entdeckt und mir gedacht: „Warum nicht, der Typ interessiert mich.“ Ich hatte den Präsidentschaftswahlkampf 2020 verfolgt, war enttäuscht vom Ergebnis und habe mich seitdem immer wieder gefragt, was passiert wäre, hätte Sanders seine Kandidatur nicht zurückgezogen.
Zunächst möchte ich anmerken, dass ich von dem Buch sehr lange sehr enttäuscht war. Das ganze erste Drittel hat eigentlich sehr wenig bis garnichts mit Kapitalismus zu tun, ist beinahe ausschließlich Selbstbeweihräucherung und eine übertrieben detaillierte Beschreibung des Wahlkampfes, abgesehen von einem kurzen Einwurf über das absurde System der Wahlkampffinanzierung in den USA.
Dabei wären wir aber schon bei einem der beiden großen Punkte, die ich aus diesem ersten Teil des Buches mitnehme (dem zweiten großen Punkt widme ich mich nächste Woche). Sanders bemängelt dieses System, in dem Milliardäre und große Konzerne beinahe im Alleingang Wahlkämpfe finanzieren und dafür zweifellos so einiges an Gegenleistungen bekommen. Er betont mehrfach, wie stolz er darauf ist, seinen eigenen Wahlkampf gänzlich ohne Großspenden geführt zu haben. Er habe damit gezeigt, dass es auch in den USA möglich ist, eine politische Bewegung groß zu machen ohne sich bereits während des Wahlkampfs an den Meistbietenden zu verkaufen. Es ist möglich, mit Idealismus allein Wahlkampf zu machen, auch ohne das Geld von Konzernen und Lobbies.
Warum, so frage ich mich, hat Bernie Sanders dieses, seinen eigenen Worten nach, enorme Momentum nicht genutzt, um eine eigene Partei zu gründen? Ein häufig genannter Grund, warum Parteien jenseits der Demokraten und Republikaner bei größeren Wahlen so gut wie keine Bedeutung haben, ist der, dass es ohne die entsprechende Finanzierung in den USA einfach nicht möglich ist, im Wahlkampf ausreichend präsent zu sein. Sanders hätte die Mittel gehabt, es zumindest zu versuchen.
Bernie Sanders war den Mächtigen in der Demokratischen Partei zu progressiv, das ist kein Geheimnis. Bereits während des Wahlkampfs 2020 war schnell klar, dass der Politiker von seiner eigenen Partei zu wenig Unterstützung erhalten würde, um erfolgreich zu sein. Aus Angst vor einem Wahlsieg Trumps zog er schließlich seine eigene Kandidatur zurück und unterstützte Biden, in der Hoffnung, die Stimmen der demokratischen Wähler so hinter einem Kandidaten zu einen. Ich bezweifle stark, dass das im Sinne seiner Unterstützer gewesen ist.
Sanders beschreibt in seinem Buch, dass er seinen Einfluss unter der Biden-Regierung nutzen konnte, um einige seiner Anliegen zumindest in abgeschwächter Form durchzusetzen. Viel öfter und ausführlicher beschreibt er allerdings, wie viel ihm verwehrt wurde, weil es in „seiner“ Partei viel zu wenige Menschen gab, die seine Ansätze und Ansichten teilen. Wie Abstimmungen außerdem im Senat trotz einer absoluten Mehrheit der Demokraten zu deren Ungunsten ausfielen, weil es innerhalb der Demokratischen Partei immer wieder einzelne Personen gab, die die von der eigenen Partei eingebrachten Vorschläge nicht mittragen wollten. Was hat man dann eigentlich davon, für die Demokraten im Senat zu sitzen? Hierzu ist anzumerken, dass Bernie Sanders tatsächlich offiziell als Unabängiger im Senat sitzt, sich allerdings der Fraktion der Demokraten (Democratic Caucus of the United States Senate) angeschlossen hat.
Und die große Frage, die sich mir nach alldem stellt: Warum sollte man als Nicht-Republikaner in den USA überhaupt noch zur Wahl gehen? Nehmen wir Donald Trump, der sich bereis in seinem Wahlkampf in seiner Radikalität durchaus von bisherigen republikanischen Kandidaten abhob, einmal aus der Rechnung vollständig heraus und reden nur über den Senat. Realistischerweise hat man die Wahl, für seinen Bundesstaat den republikanischen oder den demokratischen Kandidaten zu wählen. Andere Kandidaten stehen oft nicht zur Wahl (die Hürden für eine Kandidatur sind teilweise extrem hoch) oder gehen ohne das nötige Budget im Wahlkampf unter.
Nun angenommen, ich sei Demokrat. Dann könnte ich bei der Senatswahl die Republikaner wählen, die ganz sicher nicht in meinem Interesse abstimmen. Oder ich könnte die Demokraten wählen, die statistisch gesehen auch nicht in meinem Interesse abstimmen. Selbst bei einer absoluten Mehrheit der Demokraten im Senat findet sich für zahlreiche Anträge der Demokraten im Senat keine absolute Mehrheit. Während ich es prinzipiell positiv sehe, wenn Mandatare nicht verpflichtet sind, immer entsprechend ihrer Parteilinie abzustimmen, ist eine solche Situation für demokratische Wähler nachvollziehbarerweise frustrierend.
Noch schwieriger muss die Wahl für jemanden sein, der sich tatsächlich Veränderungen wünscht, vielleicht sogar ein besseres Gesundheits-, Bildungs- oder Sozialsystem. Für diese Menschen steht eigentlich niemand zur Wahl. Die einzige Person, die sich für diese Ziele eingesetzt hatte und, so schien es, damit Erfolg hätte haben können, hat sich schließlich einer der Parteien angeschlossen, die eigentlich alles möglichst im Status quo belassen wollen.
Ja, Bernie Sanders sitzt nach wie vor im Senat. Aber wo waren die Kandidaten einer potenziellen Bernier-Sanders-Partei in den anderen Bundesstaaten? Wenn die Unterstützung für seine Bewegung tatsächlich so groß war, wie Sanders in seinem Buch behauptet, vielleicht könnten im Senat jetzt statt einem sogar zehn Bernies sitzen, oder mehr. Vielleicht hätten Kandidaten dieser neu gegründeten Partei die teils absurden Hürden für eine Kandidatur überwinden, hätte der Wunsch nach Veränderung tatsächlich die Massen mobilisieren können.
Vielleicht auch nicht. Aber da war nun jemand, der vielleicht tatsächlich in einem starren System etwas hätte verändern, vielleicht tatsächlich die Welt hätte bewegen können. Und er hat nicht. Und immer wieder frage ich mich, was könnte jetzt alles anders sein?